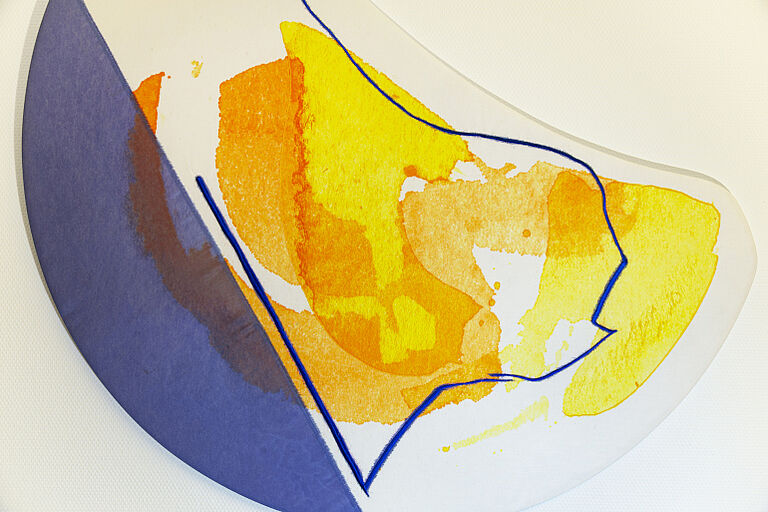4. Fastenpredigt am Sonntag Invokavit, 22. März 2020
Vierte Fastenpredigt zu Jesaja 66,13; Sonntag Lätare, 22. März 2020, 9.30 Uhr; St. Laurentius, Neuendettelsau; Prof. Dr. h.c. Heribert Prantl
„Alpha und Omega: Das Wohlergehen von Alten und Jungen gehört zusammen.“
Prof. Dr. h. c. Heribert Prantl
Mit den liturgischen Farben bin ich - als ehemaliger Ministrant der katholischen Pfarrei von Nittenau in der Oberpfalz – einigermaßen vertraut. Ich bin auch damit einigermaßen vertraut, an welchen Festen man sie trägt: Da ist das festliche Rot und das hoffnungsvolle Grün, da ist das Weiß der hohen Christusfeste, da ist das Violett zur Vorbereitung auf diese Feste und da ist das Schwarz als Farbe der Trauer.
Die Farbe Rosa als liturgische Farbe ist mir aber trotz meiner einschlägigen Erfahrungen bisher noch nie begegnet. Es ist, wie ich in der Vorbereitung auf die heutige Predigt gelernt habe, eine liturgische Nebenfarbe – die nur an zwei Tagen im Jahr aktuell ist: Am dritten Adventssonntag, genannt Gaudete; und am vierten Fastensonntag, genannt Laetare. Dieser vierte Fastensonntag ist heute.
Dieser Sonntag Laetare ist ein Sonntag des Dazwischen – da ist einerseits noch der Ernst der Passion und andererseits schon die Vorfreude auf Ostern. Und das Rosa bringt dies farblich zum Ausdruck: Diese Farbe liegt ja zwischen dem Violett der Fastenzeit und dem Weiß der Auferstehung.
Rosa als liturgische Farbe – für eine solche Entdeckung bin ich Ihnen und der Ökumene dankbar. Es ist schön und ehrenvoll, dass sie einen ehemaligen katholischen Ministranten einladen, an ihrer evangelischen Fastenpredigt-Reihe mitzuwirken. Solche Großzügigkeit habe ich auch schon erfahren dürfen, als mir die evangelische Fakultät der Universität Erlangen vor ein paar Jahren die Ehrendoktorwürde verliehen hat. Nun können Sie sich bei meiner heutigen Predigt selber ein Urteil bilden, ob diese Ehre auch verdient ist.
Die Farbe der Liturgie hat etwas mit meinem Predigt-Thema von heute zu tun und dem heutigen Predigttext aus dem Buch Jesaja, der die Grundlage dafür sein soll. In ihm sagt Gott: „Ich will euch trösten wie einen seine Mutter tröstet“. Die Farbe Rosa ist da eine tröstliche Erinnerung an meine verstorbene Mutter, die Schneidermeisterin war – und deren Schrank voll war von wunderbaren Kostümen, die sie sich am liebsten in Rosa geschneidert hatte, Rosa in allen Tönen.
„Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet“: Mir ist dieser Predigttext eine wunderbare Erinnerung an meine Mutter, und er ist für uns alle Einladung, uns Gott einmal ganz anders vorzustellen als üblich – nicht als König, nicht als Vater, nicht als Hirt, nicht als Befehlshaber einer Schar von Engeln, sondern als Frau, als Mutter, als Mutter, die tröstet. Es ist dies eine faszinierende Vorstellung: Die Mutter hat uns geboren, sie hat uns erzogen, sie hat uns begleitet, sie hat uns gehen und wieder kommen lassen. Nicht jeder hatte eine tröstende Mutter. Meine Mutter war so eine tröstende Frau. Wer eine solche Mutter hat oder hatte, der weiß, welch wunderbare Vorstellung es ist, sich Gott als tröstende Mutter vorzustellen.
Sie hat mir das Einmaleins beigebracht, sie hat die Englisch- und Lateinvokabeln abgefragt, sie hat mit mir und meinen Geschwistern gebetet, aber natürlich, sie hat auch geschimpft. Sie saß am Bett, wenn wir krank waren, sie hat unsere Tränen abgewischt. Und sie war dann auch wieder für uns da, als wir älter waren und sie schon alt war, sie war da in den Krisen unseres Lebens. Gott, die Latein-Vokabeln abfragt, die uns umarmt, die Tränen abwischt, die uns an ihr Herz drückt, die Rat und Trost gibt – die es später auch erträgt, wenn man sie als etwas nervig empfindet, weil man selbst ja hinaus in die Welt und ins Leben gegangen ist, die Mutter aber einen an das alte Leben und seine Regeln erinnert und daher Fragen stellt, die einem gerade nicht passen.
Die letzten zehn Jahre ihres Lebens hat meine Mutter im Altersheim St. Rita in Oberhaching verbracht. Wann immer es ging, war ich am Sonntag bei ihr. Wir besuchten zusammen den Gottesdienst, sangen zusammen die alten Lieder. Erst war sie noch gut zu Fuß unterwegs, dann stützte sie sich auf den Rollator, dann kam der Rollstuhl. Wir lachten miteinander, fuhren miteinander spazieren durchs Oberland – und wenn ich zu schnell fuhr, sagte sie: „Langsam, ich will noch länger leben“. Aber dann, nach ihrem neunzigsten Geburtstag, wurde sie, wie man so sagt, immer weniger. Es war wie bei der Abschieds-Sinfonie. Sie kennen diese Sinfonie von Joseph Haydn, bei der die Musiker der Reihe nach ihre Noten zuklappen, das Licht auslöschen und sich von der Bühne verabschieden. So ähnlich war es mit den Lebensgeistern meiner Mutter. Sie war dement.
Für uns wie für Gott bedeutet älter werden, den Tod vor Augen zu haben. Natürlich wird eine Mutter Gott niemals sterben, aber sie sieht unser Altern und unser Sterben – sie hat Erfahrung damit, von Urzeiten an, sie hat unendlich viele Menschen verlöschen und sterben gesehen. Sie nimmt unser Gesicht in ihre Hände und sagt: Hab keine Angst. „Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet“.
Mit dem Geist, so glauben viele, verschwindet die Würde. Das ist falsch: Die Würde verschwindet nicht. Sie wird einem allzu oft genommen in einem Gesundheitssystem, das Pflege auf das Allernotdürftigste beschränkt. Solche Würdelosigkeit im Leben ist für viele schlimmer als der Tod, sie ist ein langer Karfreitag – gewindelt, gefüttert, verlacht und verspottet - gekreuzigt, gestorben und begraben. Wer der Demenz begegnet – und ich bin ihr oft begegnet in Alten- und Pflegeheimen - begegnet der eigenen Angst; mit ihr bleibt jeder allein in einer Welt, die auf Leistung getrimmt ist: Der Angst davor, die Kontrolle über sich zu verlieren, der Angst davor, umfassend angewiesen zu sein auf andere, der Angst davor, nicht mehr zu wissen, wer man selber ist. Gunter Sachs, der Bonvivant und Kosmopolit, hat sich deswegen erschossen. Niemandem steht ein Urteil über einen solchen selbstbestimmten Austritt aus dem Leben zu. Es ist eine Entscheidung, die zu respektieren ist – umso mehr, als die Gesellschaft den Respekt vor dementen Menschen vermissen lässt. Nicht selten erinnert die Pflege der Alten weniger an Pflege als an Strafe dafür, dass sie so alt geworden sind.
In die Lebens- und Arbeitswelt der Noch-Nicht-Alten passen die Alten nicht. Viele Familien nehmen es gleichwohl auf sich, ihre Alten zu Hause zu pflegen. Diese Pflege in der Familie verlangt ungeheure Anstrengung. Früher hat man Aufopferung dazu gesagt. Eine bezahlbare Haus-Betreuung durch Fachkräfte gibt es nicht. Eine Kultur, die die Lebenszeit so sehr verlängert hat, hat noch keine wirkliche Antwort auf die Fragen gefunden, die damit einhergehen. Sie hat nicht die Kraft, die Menschen in Würde alt und lebenssatt werden zu lassen. Eine Gesellschaft ist aber verrückt, wenn diese Alten in dieser Gesellschaft nicht in Würde ver-rückt werden können.
Ostern steht vor der Tür. An Ostern ist viel von Erlösung und Auferstehung die Rede. Erlösung: Bei diesem Wort denken viele heute eher an Freitod und Sterbehilfe als an ewiges Leben. Wer wird durch den Freitod erlöst? Erlöst sich der alte Mensch selbst – oder erlöst sich die Gesellschaft von ihm als Belastung? Gibt sich der alte Mensch zur Entlastung der Gesellschaft gehorsam selbst auf und folgt mit dem Freitod einem unausgesprochenen Verlangen? Im Jahr 2050 werden in Europa mehr als 70 Millionen Menschen über 80 Jahre alt sein. Bei Aldous Huxley, in seiner „Schönen Neuen Welt“, wird beschrieben, wie alte Menschen in Kliniken entsorgt werden. Sie werden abgeschaltet wie verrostete Maschinen. Kinder werden in diese Entsorgungskliniken geführt und dort mit Schokolade gefüttert, damit sie sich an den Vorgang des Abschaltens gewöhnen und akzeptieren lernen, dass das Leben technisch produziert und technisch beendet wird. So verändert eine pervertierte Marktökonomie das Leben: Sie betrachtet es als Produkt, das der Herstellung und Entsorgung bedarf. Ist das die Gesellschaft, in der man leben will?
Es geht um die, die ein Leben lang gerackert haben und es jetzt nicht mehr können. Sie gelten durch ihre bloße Existenz als Infragestellung dessen, was für normal gehalten wird: Leistung, Fitness, Produktivität. Ein System aber, das nicht in der Lage ist, sich um die Alten zu kümmern, ist selber dement. Es braucht die Auferstehung von Nächstenliebe und wärmender Fürsorge. Das System muss aus seiner Hölle gezogen werden.
Man muss das so sagen, nicht nur, weil bald Ostern ist. Jeder zweite 85-Jährige in Deutschland lebt allein, ist allein. „Ehre Vater und Mutter, auf dass du lange lebst und es dir wohl ergehe auf Erden“. So steht es im vierten der zehn Gebote. Das klingt antiquiert, ist es aber nicht. Dieses Gebot fordert eine Gesellschaft, in der Alte nicht Angst haben müssen, in die Wüste geschickt zu werden.
Meine Großmutter ist, nach einem Leben in der Großfamilie, 1962 gestorben. Sie war 77. Seitdem sind bekanntlich immer mehr Menschen immer älter geworden. Das gilt der Gesellschaft offenbar als eine natürliche Schuld, die Sanktionen nach sich ziehen muss, welche in Alten- und Pflegeheimen vollzogen werden. Die organisierte Entwürdigung der Alten ist nicht die Regel, aber leider auch nicht die Ausnahme. Indes: Nicht die Demenz ist neu, die hohe Zahl der dementen Menschen ist neu. Früher starben die meisten Menschen lange bevor sie der Demenz nahe kamen. Heute erleben ganz viele, was früher nur wenige erlebt haben – zum Beispiel der alte King Lear: „Ich fürchte fast, ich bin nicht recht bei Sinnen. Mich dünkt, ich kenn' Euch, kenn' auch diesen Mann. Doch zweifl' ich noch, denn ich begreif' es nicht, an welchem Ort ich bin. All mein Verstand entsinnt sich dieser Kleider nicht, noch weiß ich, wo ich die Nacht schlief. Lacht nicht über mich.“ William Shakespeare lässt das den King Lear sagen, im vierten Akt, siebente Szene. King Lear ist dement.
So viele Menschen sind heute King Lear. Die Beziehung zu ihnen kann ein bitteres und zugleich bereicherndes, ein königliches Erlebnis sein. Klaus Dörner zitiert in seinem schönen Buch über das Altern die Erinnerungen von Eleonore von Rotenhan an ihre demente Mutter: „Als sie nicht mehr sprechen konnte, erreichte unsere Beziehung einen existenziellen Tiefgang wie zuletzt vielleicht in der Kindheit.“ Diese Erfahrung ist eine Erfühlung.
Manchmal hört man, alte Menschen, vor allem demente, würden wieder wie die Kinder. Ich darf Ihnen dazu eine Geschichte aus meinem Leben, aus meiner Familie erzählen. Meine schon erwähnte Großmutter hatte für diese Behauptung nämlich ihre ganz eigene Deutung. Es war in der Zeit, in der die Zahnärzte noch Dentisten hießen und sich noch nicht jeder Deutsche die dritten Zähne leisten konnte: Wenn meine vielen Tanten (Großmutter hatte fünfzehn Kinder!) damals der Großmutter ihre neugeborenen Enkelkinder präsentierten, dachte die alte Frau anschließend über eine anthropobiologische Frage nach: Wie es denn komme, so sinnierte sie, dass man gemeinhin die kleinen Kinder ohne Zähne als possierlich, die zahnlosen Alten aber als hässlich betrachte? Die Zahnlosigkeit der Alten akzeptierte sie unter Bezugnahme auf das Bibelwort „wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht ins Himmelreich eingehen“ als eschatologische Notwendigkeit; und so war, theologisch höchst fragwürdig, aber für meine Großmutter sehr befriedigend, der körperliche Verfall erklärt und eingebettet in die Volksfrömmigkeit.
Allerdings: Die Kunst besteht darin, demente Menschen, die in ihrer Bedürftigkeit mit Kleinkindern vergleichbar sind, nicht wie Kleinkinder zu behandeln, sondern sie weiter als Erwachsene ernst zu nehmen. Das wird nicht nur den Alten gut tun, sondern auch den Kindern. Es wird die Kindheit der Kinder verändern, wenn sie in einer Gesellschaft aufwachsen, die ein anderes Bild vom Menschen entwickelt: Das Menschsein wird, das meine ich damit, das meine ich mit diesem anderen Bild vom Menschen, nicht am Lineal von Ökonomie und Leistungsfähigkeit gemessen. Hilfsbedürftigkeit ist dann keine Störung, die behoben werden muss, sondern gehört zum Mensch-Sein. Ein solcher Umgang mit den Zeiten an den Schwellen des Lebens wäre eine Zeitenwende.
Das Leben der Menschen ist länger geworden, viel länger. In nur einem Jahrhundert haben die Menschen bis zu zwanzig Jahren an Lebenszeit gewonnen. Früher bestand ein Leben aus Frühling, Sommer und Winter; also aus Kindheit, Arbeit und Sterben. Mit den geschenkten Jahren ist ein langer Herbst dazu gekommen. Das große und lange Altern ist so neu, dass es die Menschen noch gründlich lernen müssen. Wenn sie es gut lernen, wird das die Gesellschaft grundlegend verändern. Es wird die Gesellschaft menschlicher machen, weil die älteren Menschen Erfahrungen haben – Erfahrungen, die die Jungen noch nicht haben. Der lange Herbst wird die Gesellschaft sozialer machen, wenn die geschenkte Zeit nicht nur Freizeit, sondern auch eine soziale Zeit sein wird. Es wird, wenn es gut geht, einen neuen Gesellschaftsvertrag geben: Die Menschen im Herbst, in der dritten Lebenszeit also, wenn sie die Erziehung ihrer Kinder hinter sich haben, werden sich um die Menschen in der vierten Lebenszeit, um die ganz alten, um die im Winter also, kümmern.
Sie werden merken: Auch der demente Mensch ist ein Mensch, auch wenn er nicht mehr vernünftig zu sein scheint. Er ist eben ein Mensch mit Demenz und mit Leib und Seele, Sinnlichkeit, Kreativität und Emotion. Es wird die Kindheit und das Leben der Kinder verändern, wenn sie in einer Gesellschaft aufwachsen, die solche Erfahrungen macht.
„Kinder sind unsere Zukunft“ – das hört man in der Politik jeden Tag. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Zur ganzen Wahrheit gehört: Auch die Alten sind „unsere Zukunft“, denn die Zukunft ist das Alter.
Die Alten sind unsere Zukunft. Die Kinder sind unsere Zukunft. Deshalb erzähle ich Ihnen heute von Hänschen. Hänschen rief: "Sie haben vergessen, dass das Volk nicht nur aus Erwachsenen, sondern auch aus Kindern besteht." Hänschen ist nicht einfach irgendein Hänschen, er ist "König Hänschen der Erste". Also sagt er zu seinen Ministern: "Es soll zwei Parlamente geben, eines für die Erwachsenen, eines für die Kinder."
Das sind Pläne, die in der Politik allenfalls für ein kurzes Schmunzeln sorgen würden, bevor man sich wieder dem Soli und dem Ende des Verbrennungsmotors zuwendet. Die Geschichte vom König Hänschen ist eine wunderbare Geschichte von Janusz Korczak, dem großen polnischen Pädagogen und Schriftsteller. Er erzählt darin, wie Kinder lernen, Streit auszutragen und Alternativen zur gewohnten Ordnung zu finden. Das Buch ist schon alt, es ist 1928 auf Polnisch und auf Deutsch 1988 erschienen. Aber es ist unglaublich modern: Es lehrt die "Pädagogik der Achtung". Nicht nur in seinen Kinderbüchern, auch in seinen Waisenhäusern entwickelte Korczak ein System der Selbstverwaltung der Kinder, er baute demokratische Strukturen dort auf.
Geht nicht, sagen Sie? Es ging. Warum und wie? Das ergibt sich schon aus dem Titel seines pädagogischen Hauptwerks, es heißt: "Wie man ein Kind lieben soll". Das könnte sich auch die deutsche Politik überlegen. Die deutschen Politiker müssen sich nämlich fragen lassen: Warum ist die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen so wenig verankert hierzulande? Warum ist die Kinderrechtskonvention gesetzgeberisch so wenig präsent? Warum muss nicht jedes neue Gesetz daraufhin befragt werden, wie es sich auf Kinder auswirkt? Die Antwort könnte lauten: Weil die Kinder im Grundgesetz nicht vorkommen, jedenfalls nicht als Inhaber von Rechten. Das Grundgesetz kennt keine Kinder, bis heute nicht. Das ist schade, das ist bedauerlich, das ist merkwürdig. Das Grundgesetz schützt zwar mittlerweile auch die Tiere und die Umwelt, aber die Kinder nicht.
Alle Anläufe, daran etwas zu ändern, sind bisher gescheitert. Zwar hat das Bundesverfassungsgericht 2008 "ein Recht des Kindes auf Pflege und Erziehung" zuerkannt. Das Gericht hat dabei den Bedürfnissen der Kinder den Vorrang vor den Interessen der Eltern eingeräumt. Aber der Gesetzgeber hat sich bisher geweigert, das auch so ins Grundgesetz zu schreiben. Das muss sich ändern. Das Grundgesetz muss zu einer Heimat für Kinder werden.
Die Gegner des Kindergrundrechts verweisen auf den Schutz der Menschenwürde in Artikel 1 im Grundgesetz. Das genüge. Aber Kinder sind nicht einfach kleine Menschen. Sie sind Menschen, die besonderen Schutz brauchen. Auch andere, die diesen besonderen Schutz brauchen, sind im Grundgesetz eigens erwähnt - weil sie besondere Förderung erfahren sollen: Menschen mit Behinderungen, Frauen, Mütter.
Janusz Korczak, der Weise im Waisenhaus, hat 1942 seine Kinder, es waren an die zweihundert, ins Vernichtungslager Treblinka begleitet. Er ist mit den Kindern gestorben, ermordet von den Nazis. Korczak wollte die Kinder nicht im Stich lassen. Lassen wir sie heute auch nicht im Stich. Mit dem Kindergrundrecht kämen auch die großen Pädagogen, es kämen Janus Korczak, Maria Montessori und Johann Heinrich Pestalozzi ins Grundgesetz.
Janusz Korczak hat uns den Respekt vor den Kindern gelehrt. Der Respekt vor den Kindern und der Respekt vor den Alten gehören zusammen. Er ist das Band, welches das Leben umspannt. Zu diesem Respekt gehört es, dass Alte auch in Ruhe ver-rückt werden dürfen. Das rückt die Gesellschaft gerade. Dann ist Ostern.
Amen
Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne.
Wenn Sie sich näher über unser Angebot informieren möchten, können Sie gerne Ihre
bevorzugte Kontaktmöglichkeit hinterlassen.
Oder rufen Sie uns an unter unserer Service-Nummer:
+49 180 2823456 (6 Cent pro Gespräch)