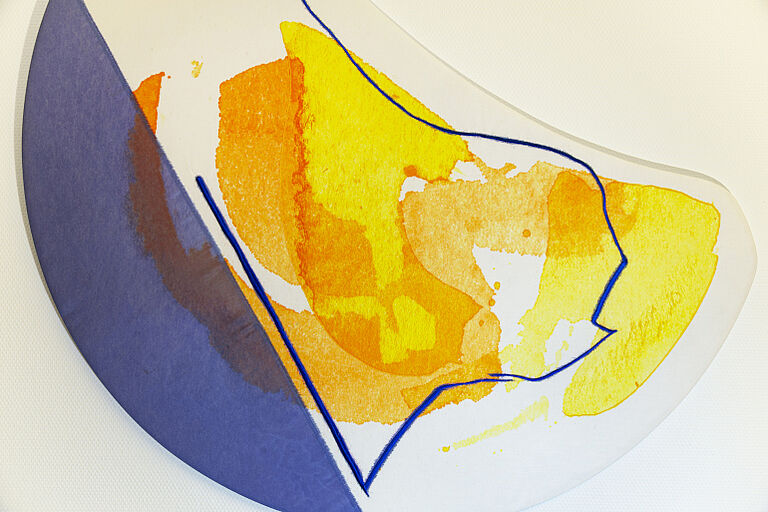Predigt vom Sonntag, 02. September 2018
Predigttext: 1. Thessalonicher 1, 2-10
Liebe Gemeinde,
ein älterer Mann erzählte mir vor Jahren von Momenten aus seiner Lebensgeschichte, die für ihn wichtig waren. Er wurde 1932 in der Nähe von Würzburg geboren und erlebte, genau wie seine Frau, als angehender Teenager den Zweiten Weltkrieg. Als Sohn eines Landwirtes erkannte er die Vorzüge der Landwirtschaft in einer solchen Krisensituation. „Zumindest hungern mussten wir nie!“, sagte er immer wieder, als ob es ein Credo wäre.
Neben vielem anderem, was er so erzählte, kam er auch auf die Zeit nach dem Krieg zu sprechen und berichtete da von materiell eigentlich noch schwierigeren Zeiten als im Krieg selbst. Für mich, der ich die Erfahrungen nicht teilen konnte, klang das alles wie aus einer anderen Welt.
Doch dann sagte er etwas, das ich so nicht erwartet hätte und das mich noch lange beschäftigt hat. „Wirtschaftlich“, sagte er, “wirtschaftlich ging es erst aufwärts, nachdem die Flüchtlinge kamen. Erst dann hat sich etwas bewegt, erst dann hat sich unser Land entwickelt“.
Ich war ziemlich verblüfft über diese Aussage, hörte ich doch ansonsten von ihm über Vertriebene, Flüchtlinge und Asylanten nur Negatives. Und allgemein war er Neuem gegenüber alles andere als aufgeschlossen. Umso mehr hat mich diese Aussage beeindruckt.
Und sie hat ein Nachdenken bei mir ausgelöst, ein Nachdenken über Fremde und Einheimische. Ein Nachdenken, das bei mir auch einsetzt, wenn ich die Worte der Bibel zum 14. Sonntag nach Trinitatis lese.
Wie am vergangenen Sonntag steht ein Samariter im Mittelpunkt des Evangeliums. War es am 13. Sonntag nach Trinitatis die barmherzige solidarische Handlungsweise, die den Samariter ausgezeichnet hat, so ist es diesmal die Dankbarkeit. Die Dankbarkeit für die eigene Heilung, die den Samariter heraushebt aus der Menge der nicht Fremden, aus der Menge der geborenen Juden. Der Fremde, der Samariter, erkennt, so könnte man die Sicht des Evangelisten Lukas beschreiben, die große Tat Gottes, die mit der Heilung durch Jesus von Nazareth geschehen ist. Die Einheimischen bleiben blind oder taub oder zumindest gleichgültig für diese Tat Gottes.
Im Abschnitt des 1. Thessalonicher-Briefes, der heute zur Predigt ansteht, geht die Thematik der Dankbarkeit weiter, ebenso, wenn auch hintergründig, die Thematik des Fremdseins.
Paulus, selbst Jude, wenn auch mit Römischem Bürgerrecht, ein Grenzgänger, einer, der mindestens zwei Welten kennt, die Jüdische und die Römische. Paulus dankt den Christen in Thessaloniki fast überschwänglich für die Art und Weise, wie sie das Christentum angenommen haben, er dankt für die Kraft, die ihr Glaube hat, und dafür, dass das Evangelium mit Kraft und mit viel gutem bzw. heiligem Geist in der Stadt unter den Menschen wirkmächtig geworden ist.
Paulus dankt auch für ihren vorbildlich gewordenen Glauben, obwohl die Gemeinde, die von ihm gegründet worden war, noch sehr jung ist.
Die Christen in Thessaloniki waren wohl zu einem Großteil griechisch-stämmige Menschen, also keine Juden, also für das Christentum zunächst Heiden, keine Juden wie Jesus und die Apostel, einschließlich Paulus selbst.
Und Paulus dankt für deren Glauben wie für ein Geschenk. Ein Geschenk, das eine große Ausstrahlung bekommen hat.
Liebe Gemeinde, die Bibelworte des heutigen Sonntags, sie sprechen von Dankbarkeit als einer der wichtigsten Haltungen des Menschseins oder auch des Christseins. Christ bin ich nicht aus eigener Kraft. Ich kann mich anstrengen wie ich will und ich muss das ganz sicher auch, aber dass Glaube in mir und zwischen uns geschieht, bleibt im Letzten immer auch ein Geschenk. Es bleibt etwas, das ich nicht verdient habe wie meinen Lohn, den ich Mitte des Monats hoffentlich wieder bekomme.
Glaube als sinnerfülltes Dasein, als Dasein, das nicht mit geistlicher Leere kämpft, die im Letzten zerstörerisch ist, zerstörerisch, weil sie mich wegführt von mir selbst.
Glaube als eine Lebenshaltung, die mich davor bewahrt, mich in sozialen Netzwerken vollkommen zu verlieren, oder die mich davor bewahrt, mich in Freizeit und anderen Aktivitäten als Mensch völlig zu verlieren.
Bitte verstehen Sie mich nicht falsch, ich möchte weder soziale Netzwerke noch irgendwelche Freizeitaktivitäten entwürdigen oder verteufeln. Es geht mir um die Haltung und auch um eine innere, eine seelische Stärke der Person, eine Stärke und Fähigkeit zu hoffen, an der ich natürlich auch hart arbeiten muss, die letztlich aber doch Geschenk bleibt. Für mich als Christen bleibt sie ein Geschenk des Glaubens, ein Geschenk Gottes, für das ich dankbar bin wie Paulus.
Liebe Gemeinde,
Ein Grund, warum ich gerne und aus Überzeugung Christ bin, ist, dass das Christentum eben keine elitäre und keine auf ein bestimmtes Volk begrenzte Religion ist.
Wir Christen haben das wichtige Werkzeug in unserem Selbstverständnis, uns als Kinder Gottes mit allen anderen Kindern Gottes über den Hass auf Menschen anderer Nationen und anderer Religionen zu erheben. Es sind im Thessalonicher-Brief die Fremden, die vorbildlich das Christentum leben.
Ich hoffe und kämpfe dafür, dass etwas von dieser christlichen Weite in die Herzen der Menschen kommt. Die Ereignisse in Chemnitz in der letzten Woche zeigen, wie wichtig das Geschenk einer solchen geistigen Weite ist, wahrscheinlich auch für den oder die Täter, die den jungen Mann erstochen haben. Sicher aber für die, die mit Gewalt für ethnische Sauberkeit in Deutschland kämpfen und vielleicht auch für die, die mit Gewalt auf den Hass von rechts antworten wollen.
Unser Glaube bleibt ein Geschenk und ist im Letzten nicht machbar und auch nicht zu ertrotzen. Er bedeutet Offenheit für die Kraft und den Geist des Evangeliums, der ein Geist der Freiheit und der Toleranz ist.
Amen